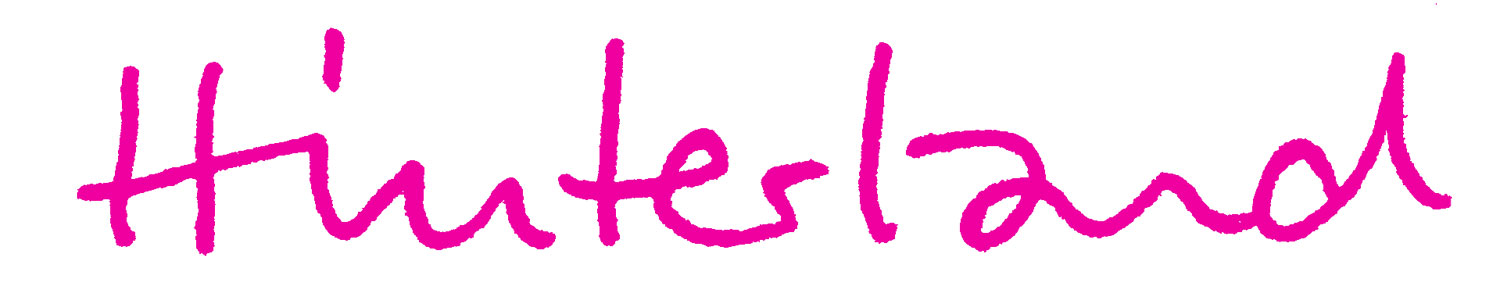Gute Migrant*innen
Gute Migrant*innen
In Deutschland ist man angekommen, wenn man nicht mehr gefragt wird, woher man „eigentlich“ kommt, sondern, wenn man den Weg zur eigenen Integration noch mal nacherzählen soll. Unabhängig davon, ob man eine Migrationsgeschichte in Form einer Einwanderung oder Flucht hat oder einen Migrationshintergrund in Form nicht-herkunftsdeutscher Eltern. Denn die akzeptierte Migrant*in, das ist kein Mensch, das ist ein Plot: Aufstieg durch Anpassung, Leistung nach Leid. Es ist das schöne Märchen von der
gesellschaftlichen Durchlässigkeit, am liebsten erzählt von Leuten, für die eine sozial und ökonomisch aufgestiegene Migrant*in als anekdotische Evidenz für die behauptete Chancengleichheit herhalten muss.
Diese Geschichte beginnt stets im Soziotop der Sozialstatistik. Es gilt, den Bildungsstand der Eltern überwunden zu haben, das Deutsch muss entweder auf Gymnasialniveau brillieren oder aber in Rekordgeschwindigkeit erlernt worden sein, wehe man gehört zu jenen, die „nach 10 Jahren in Deutschland!!!” falsch deklinieren oder Artikel verwechseln. Wenn die Vita vom Plattenbau zur Promotion führt, dann ist man willkommen – und es wird so getan, als habe die Akzeptanz schon immer und mit aller Selbstverständlich keit bestanden. Dass Menschen während der Zeit im Plattenbau behandelt werden wie Abschaum, wird im Zuge der lobenden Leistungseuphorie gerne verdrängt. Es ist, als wolle eine Gesellschaft mit ihrer
betulichen Begeisterung für die vorbildliche Biographie einer Aufsteiger*in die vorhergehenden Demütigungen vergessen machen. Die Soziologie sagt: soziale Mobilität. Die Gesellschaft sagt: Respekt. Die Integrationsbeauftragte sagt: Leuchtturm. Und irgendwo nickt ein Friedrich Merz zufrieden.